Immer wieder kommt es zu sogenannten Zufallsdelikten. Personen, die mit Waffen durch die Straßen streifen und Passanten angreifen, werden festgenommen, und manche, die davon erfahren, veröffentlichen Mordankündigungen, angeblich aus Nachahmungstaten. In der vergangenen Woche wurden landesweit 54 Personen im Alter von 30 bis 10 Jahren festgenommen, die Mordankündigungen in Online-Communities veröffentlicht hatten. Viele von ihnen sind Minderjährige, und die meisten geben an, dass es sich um einen Scherz gehandelt habe. Doch die Echtzeit-Berichterstattung und Artikel zu diesen Vorfällen, gepaart mit Beschreibungen der Täter wie „Schwertkämpfer“, „Kleinwüchsiger Mann“ und einige politische Formulierungen zur Begründung der Tat, sind angesichts der Schreie der Opfer und deren Familien in der Realität, die in diesem Kontext zu sehen sind, kaum als bloße Internet-Memes abzutun. Wie kann man dieses Phänomen der kollektiven Wutäußerungen, die in Online-Communities entstehen und sich verbreiten, abmildern, und wo findet man dafür Ansatzpunkte?
Der Soziologe Erving Goffman verglich das gesellschaftliche Leben mit einer Theateraufführung. Er argumentierte, dass Individuen je nach Bühne, auf der sie auftreten, d. h. der spezifischen physischen Umgebung und dem Publikum, das beobachtet und reagiert, verschiedene Rollen spielen und so ihr soziales Selbst verwirklichen. Er unterteilte die Bühne in drei Kategorien.
Erstens: Die ‚Bühne‘ ist ein öffentlicher sozialer Kontext mit einem größeren Publikum, das auch Fremde umfasst. In diesem Fall wird die Darbietung des Einzelnen an klare Konventionen angepasst, die auch für das Publikum gelten. Das Bewusstsein, beobachtet zu werden, führt dazu, dass der Einzelne sein Verhalten anpasst, um negative Eindrücke zu vermeiden. Dies gilt beispielsweise für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zur Arbeit oder für den Umgang mit Fremden während der Arbeitszeit. Zweitens: ‚Hinter der Bühne‘ bezeichnet eine privatere Situation mit einem kleineren Publikum aus Bekannten wie engen Freunden oder Kollegen. Auch hier findet eine Darbietung statt, aber die gespielte Rolle kommt dem näher, was der Einzelne als sein wahres Selbst empfindet. Drittens: ‚Außerhalb der Bühne‘ bezeichnet einen privaten Raum ohne Publikum und ohne Rollenerwartungen. Dies ist oft der Kontext, in dem sich der Einzelne entspannt und verhält, während er sich auf zukünftige soziale Darbietungen vorbereitet.
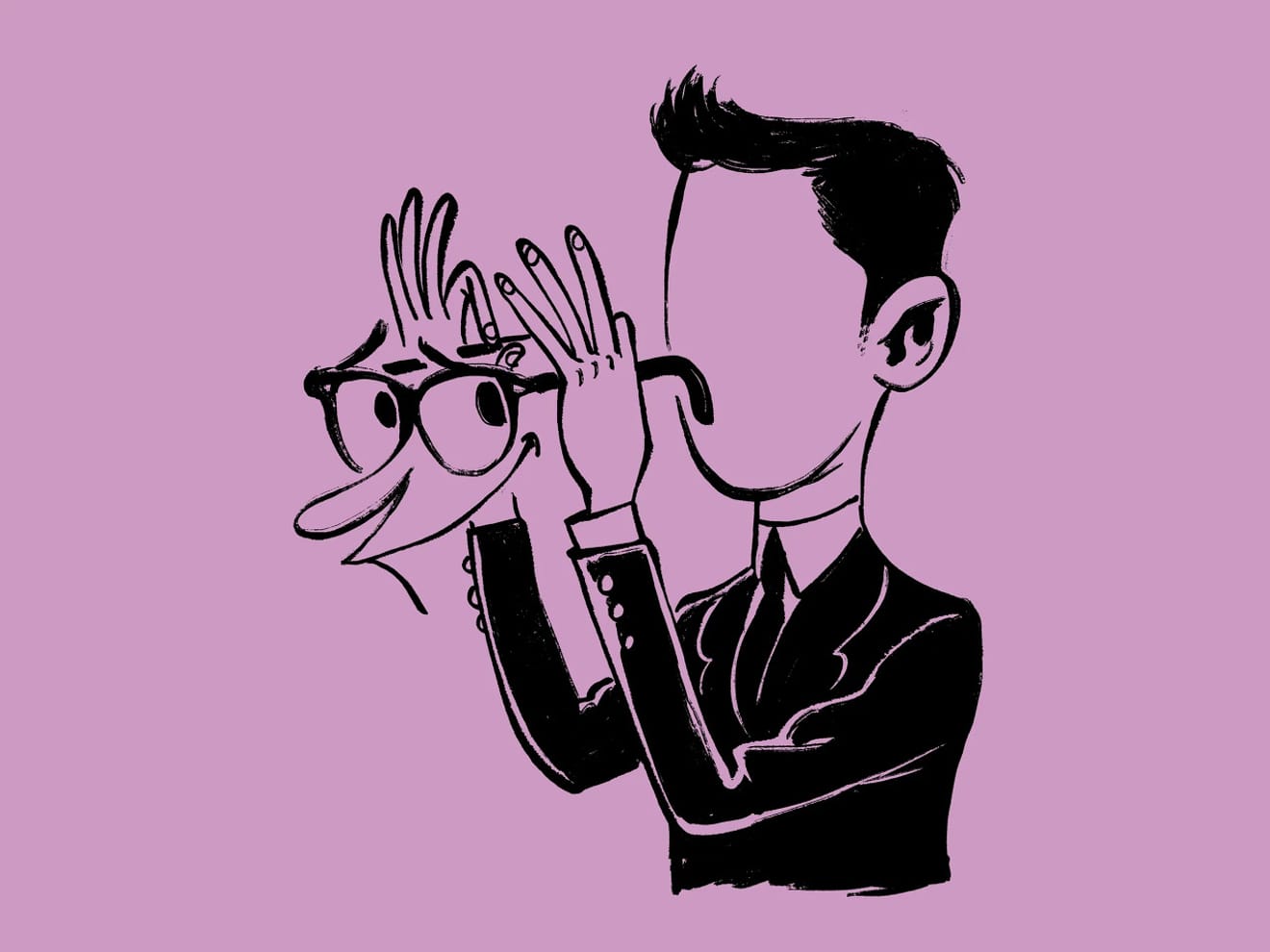
Obwohl Goffmans Perspektive auf die Interaktion von Angesicht zu Angesicht ausgerichtet ist, ist sie hilfreich, um zu verstehen, wie Benutzer in Online-Communities die Grenzen zwischen realer und virtueller Identität verschwimmen lassen und nach Alternativen zu suchen.
Zunächst einmal ist es notwendig, die gegenwärtige Situation der veränderten sozialen Identitätsbildung anzuerkennen. Jugendliche und junge Erwachsene sind es gewohnt, über Social-Media-Apps ihre eigene Bühne aufzubauen, auf der sie sich auf der Bühne, hinter der Bühne und außerhalb der Bühne präsentieren, ihre Rollen und ihr Aussehen verändern und ihr Publikum beobachten und kontrollieren. Das heißt, im Online-Raum müssen sie sich nicht an strenge Regeln, Rollen und Grenzen zwischen den einzelnen Bühnen halten. In einer Umgebung, in der die Grenzen zwischen realen und virtuellen Handlungen durch Live-Streaming und den Austausch von alltäglichen Live-Inhalten mit Followern immer mehr verschwimmen, müssen wir uns bewusst sein, dass wir in dieser Umgebung leben. Nur so können wir Bereiche identifizieren, die einer Veränderung bedürfen, die in der gegenwärtigen, prekären sozialen Wahrnehmung, die alles als individuelle Verantwortung betrachtet und verurteilt, nicht sichtbar sind.
Als Nächstes müssen wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, den Nutzern die Entscheidungsgewalt über die Offenlegung ihrer persönlichen Daten zu geben und die strukturelle Veränderung von Online-Communities zu ermöglichen, um diese Offenlegung nachvollziehbar zu machen. In der Anthropologie, Geographie und anderen Disziplinen wird der Ort als ein Raum definiert, dem Bedeutung verliehen wurde. Ein ‚Ort‘, an dem ein Individuum sinnvolle Interaktionen erleben kann, steht in Beziehung zu allen inneren und äußeren Faktoren, während ein ‚Raum‘ nur in Beziehung zu den darin enthaltenen Objekten steht und somit Grenzen aufweist.
In vielen Fällen beschränkt sich die Funktion von Online-Communities darauf, einen ‚Raum‘ zu sein, in dem nur Fragmente der individuellen Persönlichkeit geteilt werden, die man verbergen möchte, und in dem sich einfache und oberflächliche Beziehungen entwickeln. Das hat natürlich auch seine Berechtigung, aber wir erleben gerade, dass es auch notwendig ist, Online-Communities zu ‚Orten‘ zu machen, die Informationen über die Nutzer als Subjekte beinhalten, die die Regeln des Verhaltens in der Community zulassen. Die oft vorgeschlagene Lösung der Namensnennung stößt auf viele Einschränkungen, was die Umsetzbarkeit angeht. Stattdessen könnten wir vorschlagen, dass Plattformen so gestaltet werden, dass Nutzer selbst entscheiden können, wie viel sie von sich und ihrer Umgebung preisgeben möchten, wer sie sehen kann und in welchem Umfang sie mit anderen Nutzern interagieren möchten, und ihnen so die Möglichkeit geben, verschiedenen Community-Ebenen anzugehören.
Es ist nicht einfach, sich online mit dem eigenen, mit der realen Profilinformation verbundenen Selbst ganz zu offenbaren, aber es ist eine Welt, in der man neue Macht gewinnen kann, die auf Vertrauen und Chancen basiert. Das heißt, es ist auch an der Zeit für ein System, das die Entscheidungen der Nutzer, sich selbst zu zeigen, unterstützt.
*Dieser Text ist die Originalfassung eines Artikels, der am 7. August 2023 in der Zeitung ‚Electronic News‘ veröffentlicht wurde.
Referenzen
Kommentare0